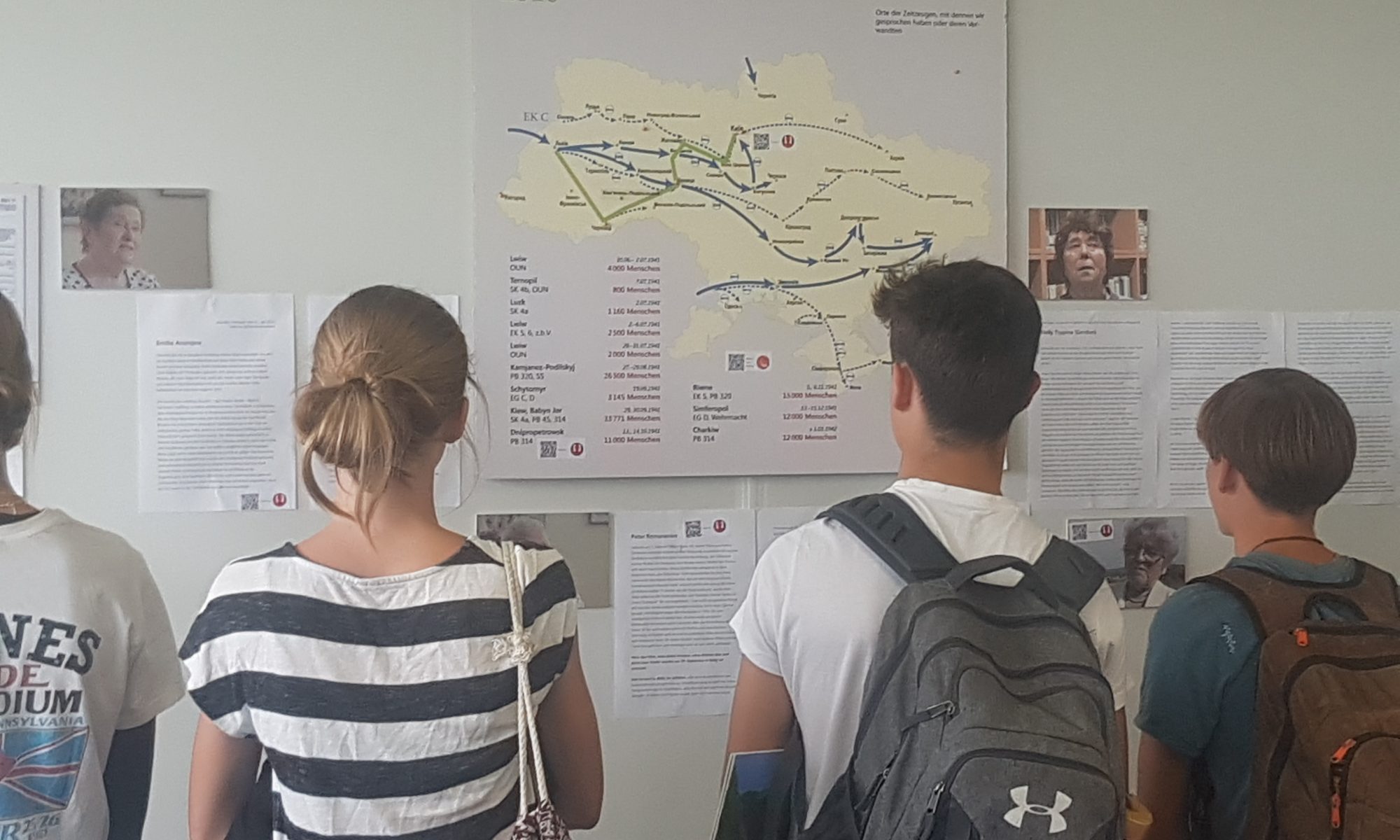„Erinnerung lernen“ und SABRA der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf gestalten „Projekttag Antisemitismus“ am Mataré Gymnasium in Meerbusch.
Meerbusch
/ Kreis Neuss
In den letzten Schultagen vor Zeugnisvergabe und großen Ferien gab es für die Meerbuscher
Europaschule mit ca. 1000 Schülerinnen und Schülern einen nicht ganz alltäglichen
Besuch.
Gleich zwei Einrichtungen der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, die Servicestelle
für Antidiskriminierungsarbeit – Beratung bei Rassismus und Antisemitismus,
kurz SABRA und „Erinnerung lernen“,
sowie der Ghetto Überlebende Herbert Rubinstein, gestalteten gemeinsam mit
Lehrkräften eine Ausstellung und einen Projekttag gegen Antisemitismus und für
die Erinnerung an die Shoa.
Diese Thematik, die in der letzten Zeit verstärkt auch im Erleben von
Jugendlichen wieder eine Rolle spielt, wurde aus den nicht einfach greifbaren Medien,
zumindest für eine Woche, in den Schulalltag geholt.
Schulleiter Christian Gutjahr-Dölls, betonte bei seiner Begrüßung in
eindringlichen Worten, wie wichtig es der Schule gerade in diesen Zeiten ist,
gemeinsam mit einem Partner wie der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf gegen das
Vergessen und für konkrete Handhabungen bei Rassismus und Antisemitismus zu
arbeiten.
Erinnerung lernen
„Wir
wollen praktisch etwas mit der Jugend tun, nicht warten bis es wieder zu spät
ist“, so Herbert Rubinstein, Mitglied der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Er überlebte
1941 gemeinsam mit seiner Mutter die Shoa in der heutigen Ukraine. In den 50er
Jahren waren er und sein Freund Paul Spiegel (sel.A.), der ehemaligen
Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland selbst noch Besucher im
jüdischen Jugendzentrum. Seit dieser Zeit fühlt sich Herbert Rubinstein auch
dem Dialog, damals zunächst mit katholischen jungen Erwachsenen verbunden.
Ukraine
„Seit nunmehr drei Jahren reist unsere Erinnerungswerkstatt durch ukrainische
Schulen, Universitäten und Bibliotheken, erstellt und übersetzt Materialien, entwickelt
Formate für die Zeit, wenn die Zeitzeugen ihre Schicksale nicht mehr persönlich
an die Jugend weitergeben können“, so Olga Rosow, Leiterin der Sozialabteilung
der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf.
Präsentiert werden u.a. die Geschichten von zwölf Zeitzeugen, ein Schulbuch im
Stile einer Graphik Novel, das die Biographien von fünf jüdischen Kindern im
Holocaust erzählt, ein elektronisches Memory zur Erklärung jüdischer Symbole, ein
Audio Spaziergang durch den Gedenkpark von Babyn Yar in Kyjiw, und ein Dokumentarfilm
über das Leben und die gestohlene Kindheit eben jenes Herbert Rubinstein
Zuletzt wurde der Comic „Das Leben von Anne Frank“ ins Ukrainische übertragen
und wird ab September in ukrainischen Schulen verteilt. Werkausstellungen
fanden zuletzt in Charkiw, Krefeld, Lemberg, Tscherkasy, Gelsenkirchen, Krementschuk,
Düsseldorf und Chernivsti statt,
Letztere in Anwesenheit des Oberbürgermeisters von Düsseldorf, Thomas Geisel, der
dazu Ende April mit einer Delegation der JGD in das heutige „Czernowitz“ gereist ist, wo viele der
Mitglieder ihre Wurzeln haben.
TRANSNATIONALES PROJEKT
„Erinnerung lernen“ ist ein transnationales Projekt auf Augenhöhe.
Alle lokalen Aktivitäten dort haben einen Bezug zu Menschen aus der
Düsseldorfer Gemeinde bzw. aus dem Landesverband Nordrhein, die meisten sind mit
dem Thema „Shoa durch Erschießen verbunden, wofür das Menschheitsverbrechen Babyn
Yar“ nur stellvertretend steht“, sagt der Historiker und Projektkoordinator
Matthias Richter.
„Alles hat in der Seniorenabteilung der Gemeinde als kleines Zeitzeugeninterview
angefangen“, ergänzt Rosow, die selber aus Kyjiw stammt. „Dass nun die
Ergebnisse aus der Ukraine, hier in Deutschland eingesetzt werden, war so nicht
geplant, macht uns aber auch ein wenig stolz und zeigt wie nötig zeitgemäße
Konzepte für dieses Arbeitsfeld sind.“
Das Projekt wird vom Auswärtigen
Amt im Rahmen des „Ausbaus der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den
Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland“ gefördert.
Partner des Projektes sind u.a. das Zentrum Judaikum Kyjiw, das Museum für die Geschichte und Kultur der Juden der Bukowina, sowie das Anne Frank Huis Amsterdam und SABRA Düsseldorf.
SABRA
Die
Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und
Antisemitismus SABRA wurde vor etwas über einem Jahr in Trägerschaft der
JüdischenGemeindeDüseldorf gegründet und ist neben RIAS in Berlin die zweite
Einrichtung dieser Art bundesweit,
unweit des Düsseldorfer Gemeindezentrums.
Das Wortspiel mit dem hebräischen Begriff für Kaktus ist gewollt. Kleine Kakteen
zieren auch Logo und das Büro.
SABRA bietet neben Einzelfall- und
Organisationsberatungen sowie Netzwerk- und Gremienarbeit auch
Präventionsprogramme gegen Antisemitismus, vor allem an Schulen.
„Mit Workshops für Schülerinnen und
Schüler ab der dritten Klasse wollen wir für den alltäglichen Antisemitismus
sensibilisieren«, so die Theaterpädagogin Sophie Brüss, von SABRA.
„Auch hier mit der Stufe 10 war es
ein Ziel, die Auswirkungen von Antisemitismus auf Jüdinnen und Juden
aufzuzeigenund aktuelle Fällen an Schulen zu diskutieren.“
„Für mich war es ein gelungener, lebendiger Workshop, bei dem die Schülerinnen
und Schüler keine Scheu zeigten, auch unangenehme Fragen , nicht nur über
Antisemitismus, sondern auch über die Unterschiede zum Rassismus und zur
Vielfalt von jüdischen Identitätenzu stellen und ihre eigenen Bilder im Kopf zu
reflektieren, so Brüss.
Projekttag
Für ungefähr 100 Schülerinnen und Schüler der Stufe 10 wurde ein Welt Café
veranstaltet bei dem Reihum die Themengruppen Antisemitismus im Alltag,
Medienkompetenz „Stereotype im Netz“, ein Dokumentarfilm mit anschließendem
Zeitzeugengespräch und der Besuch der Ausstellung organisiert.
„Wir verzeihen Generation der Täter nicht, aber die junge Generation ist nicht
schuldig, sie soll aber aufpassen, dass sie nicht schuldig wird,“ ist einer der
Aussagen die Herbert Rubinstein in dem Filmes „Ich war hier“ der ukrainische
Filmemacherin Ksenyia Marchenko gegenüber Schülern in Czernowitz gemacht hat.
Im Rahmen des Projekttages am 10.07.2019 mit den 10.
Klassen, an dem die etwa 107 Schülerinnen und Schüler in 4 Gruppen aufgeteilt
wurden, gab es je Gruppe ein etwa halbstündiges Zeitzeugengespräch mit Herbert
Rubinstein. Obwohl die Schulleitung eine gute Vorarbeit geleistet hatte, die
Schülerinnen und Schüler 2 entsprechende Filme vorher gesehen hatten, fing das
jeweilige Gruppengespräch etwas zäh an, vor allem nach der Mittagspause. Da saß
nun Herbert Rubinstein der Gruppe im Klassenraum live gegenüber, ein für sie
bis heute unbekannter älterer Mensch, von dem sie vorhin so einiges aus seinem
Leben gesehen und gehört hatten. Also musste zunächst ein Vertrauen entstehen,
Fragen stellen zu dürfen und auch, welche Fragen. In jeder Gruppe waren es etwa
4-5 Jugendliche, überwiegend weiblich, die sich dann doch trauten. Interessant
waren die Fragen wie es uns gelang, zu überleben, d.h. mehr Einzelheiten zu
Ghetto, Fluchtwege, Zustände in Czernowitz, wie und ob uns von nichtjüdischen
Menschen geholfen wurde und wie ich das, als Kind, aufgenommen und verarbeitet
hatte. Ich stellte fest, dass die Jugendlichen sich Vieles, was Krieg und
Furchtbares bedeutet, sich nicht vorstellen können. Vielleicht, weil der
überwiegende Teil hier geboren wurde, sich nicht mit Nachrichten intensiv
befasst und in einer überwiegend heilen Welt lebt, die Schule, Sicherheit, ein
„normales“ zu Hause und 2019 im Rheinland bedeutet. Ja, Antisemitismus, 2.
Weltkrieg, Geschichte, Nationalsozialismus, alles nicht unbekannt und doch
unbekannt. Also hatte ich den Eindruck, entweder Verdrängung oder klar, die
Filme gesehen, aber „eine andere Zeit und Welt“. Auf meine Frage, sie seien
doch 16 Jahre und wahlberechtigt, also mit verantwortlich, was politisch vor
sich geht, gab es kaum Resonanz.